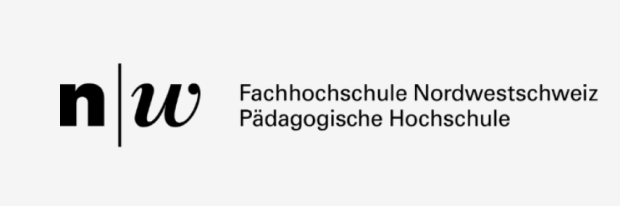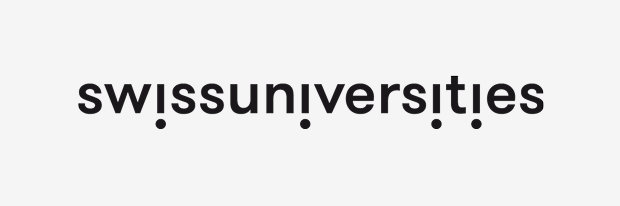Veranstaltungen – Kolloquien
An den Forschungskolloquien erhalten Interessierte die Möglichkeit, ihre Forschungsprojekte vorzustellen und gemeinsam mit Teilnehmenden aus Fachwissenschaft, Fachdidaktik und Praxis zu diskutieren. Falls Sie Interesse haben, Ihr Forschungsprojekt im nets21-Kolloquium vorzustellen, melden Sie sich bei:
Nächste Veranstaltung:
Inhalte
Das 12. Kolloquium widmet sich dem Projekt "Alltagsgespräche als Bildungschancen auf der Unterstufe (AllBi-U)". Dieter Isler (PH Thurgau) und Noemi Hueber (PH Thurgau) stellen das Projekt (inkl. Datensitzung) sowie das zugehörige Dissertationsprojekt vor.
Im Anschluss soll der informelle Austausch bei einem gemeinsamen Apero im Restaurant «piu» weitergeführt werden. Wir freuen uns über zahlreiche Interessierte!
Organisation
Britta Juska-Bacher (PH Bern)
Vergangene Veranstaltungen:
Inhalte
In der Projektpräsentation (Dissertation) von Dilan Cümen (PH Bern) wird der Stellenwert von Geschwistern im Kontext literaler Resilienz untersucht. Das Forschungsdesign kombiniert qualitative und quantitative Methoden, um die Rolle von Geschwistern im Prozess des Lese- und Spracherwerbs zu beleuchten. Das Team von Sinja Ballmer et al. (PH Zug) befasst sich in seinem Projekt mit Sprachkompetenz-Überprüfungen an Deutschschweizer PHs im systematischen Vergleich. Ausserdem werden mündliche und schriftliche Kompetenzanforderungen für (angehende) Kindergarten- und Primarlehrpersonen formuliert, auf deren Grundlage sprachliche Kompetenzen transparent und systematisch ins Curriculum eingebettet werden könn(t)en.
Im Anschluss soll der informelle Austausch bei einem gemeinsamen Apero im Restaurant «piu» weitergeführt werden. Wir freuen uns über zahlreiche Interessierte!
Organisation
Britta Juska-Bacher (PH Bern)
Das zehnte Kolloquium widmet sich zwei Forschungsprojekten, die sich mit dem (digitalen) Schreibenlernen und dem Schriftwissen auf der Primarstufe befassen.
In der Projektpräsentation von Larissa Greber (PH Zürich) wird untersucht, wie Erstklässler:innen beim silbenbasierten Schreiben vorgehen (implizites operatives Rechtschreibwissen) und welche Rolle dabei explizites Rechtschreibwissen spielt. Martina Conti (PH St. Gallen) befasst sich in ihrem Projekt mit einem Literaturreview zu digitalen Lehr- und Lernsettings im Schreibunterricht. In der Datensitzung werden Kodierschema und Datenauswertung (N = 83 relevante Publikationen) diskutiert.
Im Anschluss soll der informelle Austausch bei einem gemeinsamen Apero im Restaurant «Reithalle» weitergeführt werden. Wir freuen uns über zahlreiche Interessierte!
Organisation
Judith Kreuz & Stefan Hauser (PH Zug)
Das neunte Kolloquium widmete sich zwei Forschungsprojekten, die mündliche Prüfungs- und Leistungssituationen an Pädagogischen Hochschulen und Berufsschulen aus Sicht von Studierenden und Dozierenden sowie Praxislehrpersonen/Mentoratspersonen beleuchten.
In der Datensitzung von Judith Kreuz, Nadine Nell-Tuor und Stefan Hauser (PH Zug) werden mündliche Prüfungsinteraktionen (Basis- und Diplomprüfungen) von Primarschulstudierenden aus den Fächern Englisch, Sport & Bewegung, NMG sowie Deutsch mittels Videos und Transkripten präsentiert und sowohl gesprächsanalytisch als auch hochschuldidaktisch diskutiert.
Nicole Ackermann (PH Zürich) stellt in ihrer Datensitzung das Forschungsprojekt «Portfolio in der beruflichen Bildung» vor. In diesem Projekt werden Ausprägung und Veränderung transversaler Kompetenzen – Dokumentieren, Reflektieren und Präsentieren – kaufmännischer Lernenden durch die Arbeit am Portfolio mittels eines explorativen und fallbasierten Forschungszugangs beforscht.
Organisation
Judith Kreuz & Stefan Hauser (PH Zug)
Inhalte
Das achte Kolloquium ist das letzte Kolloquium des nets21 im Rahmen der PgB-Förderperiode. Es widmet sich zwei Forschungsprojekten, die Sprachlichkeit sowohl aus der Perspektive der mündlichen Interaktion (im Kindergartenalltag) als auch in Bezug auf das Schreiben beleuchten.
Claudia Hefti (PH Thurgau) stellt in ihrer Datensitzung eine qualitativ-rekonstruktive Fallstudie vor, in der Einsatz und Nutzung von Bilderbüchern im Kindergartenalltag erforscht werden. Dabei werden Praktiken untersucht, die durch Lehrpersonen, Kinder sowie das Bilderbuch als Akteur:innen interaktiv vollzogen werden. Im Fachvortrag mit Workshop von Pascale Schaller (PH Bern) und Julia Winkes (Uni Fribourg) werden die Teilnehmenden in die Methodik der Lernverlaufsdiagnostik Schreiben eingeführt. Dazu werden Daten und Erkenntnisse aus mehreren quer- und längsschnittlich angelegten Forschungsprojekten gezeigt, die verschiedene Herausforderungen der Diagnostik illustrieren. Anschliessend werden Möglichkeiten der Implementierung des Diagnoseinstruments für den Schreibunterricht diskutiert.
Bei diesen Datensitzungen bzw. Präsentationen sollen weitere Einblicke in aktuelle Forschungsprojekte auf Doktoratsstufe und Post-Doc-Stufe gewonnen werden.
Zum Abschluss des PgB-Projekts «nets21» laden wir alle Teilnehmenden zu einem Stehlunch ein.
Organisation
Judith Kreuz & Stefan Hauser (PH Zug)
Das siebte Kolloquium widmet sich zwei Forschungsprojekten, die Sprachlichkeit sowohl aus der Perspektive der mündlichen Interaktion (im Deutschunterricht) als auch in Bezug auf das Leseverstehen (im Geschichtsunterricht) beleuchten.
Claudine Giroud (PH Zug) zeigt in ihrer Datensitzung aus dem Projekt «Lernen im Gespräch» Videosequenzen aus dem peerinteraktiven Deutschunterricht. Im Fokus stehen Kinder mit sonderpädagogischem Förderbedarf der Primarstufe. Es soll gemeinsam diskutiert werden, wie diese Kinder ihrem Lernstand entsprechend gefördert werden können. Im Fachvortrag von Sandro Brändli (PH FHNW) wird das Leseverstehen im Geschichtsunterricht fokussiert. Dazu werden die Möglichkeiten von Textanpassungen thematisiert. An Videodaten wird gezeigt, wie 8.-Klässler:innen solche Anpassungen in ihrem Leseprozess und für das eigene Verstehen nutzen.
Bei diesen Datensitzungen bzw. Präsentationen sollen weitere Einblicke in aktuelle Forschungsprojekte auf Doktoratsstufe gewonnen werden.
Zum Abschluss des Kolloquiums folgt eine kurzer Ausblick auf weitere Aktivitäten des nets21 sowie ein informeller Ausklang beim gemeinsamen Apéro.
Organisation
Rebekka Studler, Claudia Hefti und Judith Kreuz
Das sechste Kolloquium widmet sich zwei Forschungsprojekten mit Schwerpunkt auf Zyklus 1: Evamaria Zettl (PH Thurgau) thematisiert in ihrer Datensitzung Praktiken der Differenzierung im Deutschunterricht in einer von Mehrsprachigkeit geprägten 1. Klasse. Im Fachvortrag von Nadine Nell-Tuor (PH Zug) wird das personenvermittelte Zuhören im Unterricht fokussiert. Ziel des Projekts ist es, Hilfsmittel für den Unterricht gemeinsame mit Lehrpersonen zu entwickeln, wobei ein Schwerpunkt auf Zuhörstrategien liegt.
Bei diesen Datensitzungen bzw. Präsentationen sollen weitere Einblicke in aktuelle Forschungsprojekte auf Post-Doc-Stufe gewonnen werden.
Zum Abschluss des Kolloquiums folgt eine kurzer Ausblick auf weitere Aktivitäten des nets21 sowie ein informeller Ausklang beim gemeinsamen Mittagessen.
Organisation
Rebekka Studler, Claudia Hefti und Judith Kreuz
Das fünfte Kolloquium widmet sich der Vertiefung in Forschungsprojekte mit zwei ganz unterschiedlichen Schwerpunkten: Dr. Olivia Rütty-Joy (Université de Fribourg) thematisiert in ihrer Projektpräsentation die Sprachlerneignung von Fremdsprachenlehrpersonen und leitet daraus mögliche Korrelationen mit dem Lernerfolg von Schülerinnen und Schülern ab. Im Doktoratsprojekt von Jonathan Tadres (PH Zug) werden hingegen peer-interaktive Gespräche von Primarschüler:innen in den Blick genommen, die in sog. Schreibkonferenzen über Orthografie sprechen. Diese Interaktionsprozesse werden anschliessend stufenübergreifend verglichen.
Bei diesen Projektpräsentationen sollen weitere Einblicke in aktuelle Forschungsprojekte sowohl auf Post-Doc-Stufe als auch des forschenden Nachwuchses gewonnen werden.
Zum Abschluss des Kolloquiums folgt eine kurzer Ausblick auf weitere Aktivitäten des nets21 sowie ein informeller Ausklang beim gemeinsamen Apéro.
Organisation
Rebekka Studler, Claudia Hefti und Judith Kreuz
Das vierte Kolloquium widmet sich der Vertiefung in die Forschungsprojekte mit dem Schwerpunkt auf den «schülergeleiteten Klassenrat als Partizipationsmöglichkeit in der Schule» (vgl. SNF-Projekt PH Zug, 2018-2022).
Bei zwei Projektpräsentationen mit anschliessender Diskussion zu den Themenbereichen «Erzählen im Klassenrat» (Sabrina Roggenbau, PH Zug, MA-Arbeit) sowie «Fragen im Klassenrat – qualitative und quantitative Zugänge» (Lee Ann Müller, PH Zug, Dissertation) sollen weitere Einblicke in aktuelle Forschungsprojekte des forschenden Nachwuchses gewonnen werden.
Zum Abschluss des Kolloquiums folgt eine kurzer Ausblick auf weitere Aktivitäten des nets21 sowie ein informeller Ausklang beim gemeinsamen Apéro.
Organisation
Rebekka Studler, Claudia Hefti und Judith Kreuz
Das dritte Kolloquium widmet sich der Vertiefung in die Forschungsprojekte mit dem Schwerpunkt auf das Leseverstehen.
Bei zwei Projektpräsentationen mit anschliessender Diskussion zu den Themenbereichen «Online-gestützte Förderung leseschwacher Schüler:innen infolge der Covid 19-Pandemie» (Valentin Unger, PH St. Gallen & Cornelia Glaser, PH Heidelberg) sowie «Historisches Erzählen verstehen (lernen). Unterstützung des globalen Leseverstehens von Lehrmitteltexten im Fach Geschichte auf der Sekundarstufe I» (Sandro Brändli, PH FHNW) sollen weitere Einblicke in aktuelle Forschungsprojekte des forschenden Nachwuchses zur Schulsprache gewonnen werden.
Zum Abschluss des Kolloquiums folgt eine kurzer Ausblick auf weitere Aktivitäten des nets21 sowie ein informeller Ausklang beim gemeinsamen Mittagessen.
Organisation
Rebekka Studler, Claudia Hefti und Judith Kreuz
Das zweite Kolloquium widmet sich der Vertiefung in die Forschungsprojekte der Mitglieder.
Bei einem Fachvortrag mit anschliessender Diskussion zum Thema «Wortschatz – Bedeutung, Erwerb und Förderung auf der Unterstufe» soll ein weiterer Einblick in ein aktuelles Forschungsprojekt zur Schulsprache gewonnen werden.
In den sich anschliessenden Datensitzungen steht die Analyse von Unterrichtsprozessen im Mittelpunkt. Im ersten Teil der Datensitzung werden Audiodokumente und Transkripte aus dem SNF-Projekt BASCH vorgestellt und hinsichtlich ihres forschungsmethodischen Zugangs diskutiert. Im zweiten Teil wird mittels Videoaufnahmen ein sequenzanalytisches Verfahren aus dem Projekt EmTiK veranschaulicht. Danach besteht Gelegenheit für eine Diskussion der Potenziale und Grenzen dieser Zugänge für fachdidaktische Forschung.
Zum Abschluss des Kolloquiums folgt eine kurze gemeinsame Diskussion sowie ein informeller Ausklang.
Organisation
Rebekka Studler, Claudia Hefti und Judith Kreuz
Das erste Kolloquium widmet sich dem Kennenlernen der Mitglieder sowie der Präsentation und Diskussion verschiedener Forschungsprojekte.
Bei zwei Fachvorträgen zu den Themen «Sprachlern-Eignung» und «Dialekte in der schulischen Sprachförderung» soll ein vertiefter Einblick in aktuelle Forschungsprojekte zur Schulsprache gewonnen werden.
Anschliessend werden in Kleingruppen die Forschungsprojekte der Teilnehmenden kurz vorgestellt und diskutiert. Bitte bereiten Sie folgende Fragen dafür vor:
Was ist der Stand meiner eigenen Forschungsarbeit?
Welche aktuellen Fragen beschäftigen mich?
Wo habe ich Diskussionsbedarf?
Zum Abschluss des Kolloquiums folgt eine gemeinsame Diskussion über die Wünsche und Bedürfnisse zur Gestaltung zukünftiger Kolloquien sowie ein informeller Ausklang.
Organisation
Rebekka Studler, Claudia Hefti und Judith Kreuz
Afra Sturm, Stefan Hauser, Dieter Isler, Britta Juska-Bacher, Hansjakob Schneider
Veranstaltungen – Sommertagungen
An den mehrtägigen Sommertagungen fanden Vorträge und Diskussionen mit Vertreter:innen verschiedener Fachdidaktiken statt. Wechselweise wurden entweder methodische Workshops angeboten oder es fanden Datensitzungen statt, in denen konkrete Unterrichtsprozesse aus der Perspektive verschiedener Fachdidaktiken analysiert wurden. Eingeladen waren alle Mitglieder des nets21 sowie weitere Interessierte.
Mit Beendigung der Projektlaufzeit finden ab 2025 keine (eigenen) Sommertagungen mehr statt. Einzelne nets21-Angebote gibt es im Rahmen der fdd-Konferenzen.
Sommertagung 22:Fachliche Lehr-Lernprozesse und ihre Sprachlichkeit10. – 11.06.2022 | PH FHNW, Brugg-Windisch
Die Sommertagung 2022 widmet sich dem Thema «Fachliche Lehr-Lernprozesse und ihre Sprachlichkeit» aus der Sicht verschiedener Fachdidaktiken, wie Mathematik, Naturwissenschaften, Geschichte und Sprache. Im Fokus steht dabei eine Auslegeordnung, die die fachspezifischen Sichtweisen auf das Thema «Sprache» bzw. die fachspezifische Sprachlichkeit im Diskurs sichtbar machen soll.
In vier Fachvorträgen aus verschiedenen Disziplinen wird die jeweilige fachdidaktische Perspektive auf die Bedeutung der Sprache für fachliche Lehr-Lernprozesse beleuchtet. Dabei geht es z.B. um
die Rolle der Sprache im Fach als Kommunikationsmedium des Wissenstransfers und als Werkzeug des Denkens,
die fachspezifischen sprachlichen Voraussetzungen und Herausforderungen für die Lernenden,
den Einfluss der Sprache und der Sprachkompetenzen auf Fachwissen, -kompetenz, und -leistung,
die Chancen einer interdisziplinär-fachdidaktischen Bearbeitung von Fragen zu sprachbedingten Lehr-Lernprozessen, die auf eine umfassende Sprachbildung und eine bessere Teilhabe aller Lernenden am (schulischen) Lernen zielen.
Am Freitagvormittag werden in zwei Methodenworkshops (insbesondere für Nachwuchswissenschaftler:innen) sprachliche Prozesse und ihre Erforschung hinsichtlich möglicher qualitativer und quantitativer Zugänge in den Blick genommen.
Geplant sind zudem Kurzvorträge von Nachwuchsforschenden sowie ein Abschlussplenum mit Diskutant:innen.
Bitte melden Sie sich für die Tagung über den obenstehenden Link (Anmeldeformular) an.
Organisation
Rebekka Studler, Claudia Hefti, Judith Kreuz
Afra Sturm, Stefan Hauser, Dieter Isler, Britta Juska-Bacher, Hansjakob Schneider
Sommertagung 23: Sprachliches Handeln in Unterrichtsprozessen untersuchen. Fachspezifische und fachübergreifende Perspektiven21. – 22. 06.2023 | PH ZG, Zug
Die Sommertagung 2023 widmet sich der Schärfung eines fächerübergreifenden Verständnisses von Sprachlichkeit unterrichtlichen Handelns. Die Tagung legt daher den Fokus auf die Bedeutung von Sprache für Lehr-Lernprozesse sowohl aus einer fachspezifischen als auch einer fachübergreifenden Perspektive. Das Thema wird in verschiedenen Beitragsformaten aufgegriffen, in denen sowohl Unterrichtskommunikation als auch Lehr-Lernarrangements aus der Perspektive verschiedener Fachdidaktiken mit Fokus auf die «Sprachlichkeit» thematisiert werden (z.B. Mathematik, Naturwissenschaften, Geschichte und Deutsch/Sprache).
Als Keynote-Referent:innen werden Prof. Dr. Hendrik Härtig (Universität Duisburg-Essen, Physikdidaktik) sowie Prof. Dr. Vivien Heller (Bergische Universität Wuppertal, Deutschdidaktik) & Prof. Dr. Miriam Morek (Universität Duisburg-Essen, Deutschdidaktik) sprechen.
In weiteren Fachvorträgen aus verschiedenen Disziplinen wird ebenfalls die jeweilige fachdidaktische Perspektive auf die Bedeutung der Sprache für Unterrichtsprozesse und Aufgabenstellungen beleuchtet.
Ausserdem finden an beiden Tagen interdisziplinäre Datensitzungen statt, in denen sowohl aus fachdidaktischer als auch deutschdidaktischer Perspektive Videodaten und Aufgabenstellungen aus dem (Fach-)Unterricht gemeinsam analysiert und diskutiert werden. Der gemeinsame Austausch findet in einer Podiumsdiskussion mit Vertreter:innen der Fach- und Deutschdidaktik seinen Abschluss.
Bitte melden Sie sich für die Tagung über den obenstehenden Link (Anmeldeformular) an.
Organisation
Rebekka Studler, Claudia Hefti, Judith Kreuz
Afra Sturm, Stefan Hauser, Dieter Isler, Britta Juska-Bacher, Hansjakob Schneider
Sommertagung 24: Professionalisierung in der Lehrerinnen- und Lehrerbildung22. – 23.08.2024 | PH BE, Bern
Die Sommertagung des Forschungsnetzwerks «Schulsprachdidaktik | nets21» widmet sich der Professionalisierung von Lehrpersonen. Die Tagung geht den Fragen nach, wie bei (angehenden) Lehrpersonen ein fächerübergreifendes Verständnis von Sprachlichkeit des unterrichtlichen Handelns aufgebaut werden kann. Der Fokus liegt dabei nicht nur auf der Bedeutung von Spra-che für Lehr-Lernprozesse, sondern auch auf Möglichkeiten ihrer Implementierung durch Aus- und Weiterbildung von Lehrpersonen sowie durch Schulentwicklung.
Als Keynote-Referent:innen werden Prof. Dr. Lena Wessel (Universität Paderborn, Mathematikdidaktik), Prof. Dr. Anke Schmitz (PH FHNW, Deutschdidaktik) sowie Prof. Dr. Afra Sturm (PH FHNW, Deutschdidaktik) & Prof. Dr. Dieter Isler (PH Thurgau, Deutschdidaktik) sprechen.
In weiteren Fachvorträgen aus verschiedenen Disziplinen werden ebenfalls die Professionalisierung von Lehrpersonen sowie die jeweilige fachdidaktische Perspektive auf die Bedeutung von Sprache im Unterricht beleuchtet.
Ausserdem finden an beiden Tagen interdisziplinäre Diskussionsrunden im Anschluss an die Keynotes mit allen Teilnehmenden statt, in denen sowohl aus fachdidaktischer als auch deutschdidaktischer Perspektive zentrale Thesen aufgegriffen und diskutiert werden. Der gemeinsame Austausch findet in einer Podiumsdiskussion mit Vertreter:innen der Fach- und Deutschdidaktik sowie der Bildungspolitik seinen Abschluss.
Organisation
Rebekka Studler, Claudia Hefti, Judith Kreuz
Afra Sturm, Stefan Hauser, Dieter Isler, Britta Juska-Bacher, Hansjakob Schneider
Veranstaltungen – Wintertagungen
Die Wintertagungen dienten der Programmgruppe zur Konzeption und Planung der Sommertagungen. Die Teilnahme an einem Fachvortrag sowie der informelle Austausch beim gemeinsamen Apéro standen auch den übrigen Mitgliedern und weiteren Interessierten offen.
Mit Beendigung der Projektlaufzeit finden ab 2025 keine Wintertagungen mehr statt.
An der Auftaktveranstaltung des nets21 spricht Prof. Dr. Markus Rehm (PH Heidelberg) zum Thema «Chancen und Grenzen interdisziplinärer Zusammenarbeit unterschiedlicher Fachdidaktiken». Zu diesem Vortrag und der anschliessenden Diskussion sind Interessierte herzlich eingeladen.
In internen Sitzungen wird ausserdem mit der Kerngruppe, der Programmgruppe und Gästen aus verschiedenen Fachdidaktiken die Gesamtausrichtung des nets21 für die nächsten drei Jahre diskutiert.
Öffentlicher Fachvortrag:
Markus Rehm (PH Heidelberg): Chancen und Grenzen interdisziplinärer Zusammenarbeit unterschiedlicher Fachdidaktiken
Im Vortrag wird anhand eines kooperativen Projekts der Mehrwert der interdisziplinären Zusammenarbeit unterschiedlicher Fachdidaktiken aufgezeigt und reflektiert. Dieser Mehrwert ergibt sich einerseits durch die „unterschiedliche Arbeit am Gleichen“ und andererseits durch das gemeinsame „Ziehen am gleichen Strang“. Anhand des Forschungs- und Nachwuchskollegs „Effektive Kompetenzdiagnose in der Lehrerbildung“ (EKoL) wird deutlich, wie Qualifizierende und Betreuende aus den Fachdidaktiken Deutsch, Geschichte, Mathematik, Naturwissenschaften und Technik in diesem Kolleg zusammengearbeitet haben. Im Vortrag wird zum einen das Kolleg in seiner Struktur und von seinem Hintergrund her vorgestellt, zum anderen wird versucht, Gelingensbedingungen einer interdisziplinären Zusammenarbeit abzuleiten. Die Gelingensbedingungen werden in zwei Modellen dargestellt: Im Modell I arbeiten die unterschiedlichen Fachdidaktiken an ihren eigenen, aber vergleichbaren Zielen (im Kolleg EKoL war das die Bearbeitung eines Vignettentests in jeder Domäne). Hierbei stehen die einzelnen Fachdidaktiken vor dem jeweils formal gleichen Problem, das aber eine domänenspezifische Lösung verlangt. Die interdisziplinäre Arbeit ergibt sich aus den unterschiedlichen und domänenspezifischen Lösungsstrategien, die gemeinsam nutzbar werden. Im Modell II arbeiten die Fachdidaktiken zusammen an ein und derselben Aufgabe (im Kolleg EKoL war das die Datenerhebung mit dem Ziel des jeweils möglichen Datenaustauschs sowie der Datenanalyse). Die Grenzen der interdisziplinären Zusammenarbeit ergeben sich dann aus den jeweiligen Arbeitskulturen der zugehörigen Fachdisziplinen. Im Vortrag wird dies am Beispiel der Forschungstraditionen und anhand der unterschiedlichen Herangehensweisen an die Datenanalyse sowie an den unterschiedlichen Disseminationsstrategien deutlich.
Organisation
Rebekka Studler, Claudia Hefti, Judith Kreuz
Afra Sturm, Stefan Hauser, Dieter Isler, Britta Juska-Bacher, Hansjakob Schneider
An der zweiten Wintertagung des nets21 spricht Prof. Dr. Christine Pauli (ZELF, Université de Fribourg). Zu diesem Vortrag und der anschliessenden Diskussion sind Interessierte herzlich eingeladen. Der Ausklang des Vormittags findet bei einem gemeinsamen Mittagessen in der Mensa der PH Zürich statt.
In internen (Daten-)Sitzungen am Nachmittag wird ausserdem mit der Kerngruppe und der Programmgruppe aus verschiedenen Fachdidaktiken die Sommertagung 2023 des nets21 geplant. Schwerpunkt ist die Diskussion des Formats interdisziplinärer Datensitzungen.
Öffentlicher Fachvortrag:
Christine Pauli (Uni Fribourg): Unterrichtsgespräche dialogisch(er) führen lernen – Konzeption und ausgewählte Ergebnisse der Interventionsstudie «Socrates 2.0»
Es besteht zunehmender Konsens darüber, dass dialogisch geführte Unterrichtsgespräche wertvolle Lerngelegenheiten für die Schüler*innen darstellen, und dies in nahezu allen Schulfächern. Ziel der Interventionsstudie „Socrates 2.0“ war es deshalb, zu untersuchen, wie Mathematik- und Geschichtslehrpersonen durch eine videobasierte Weiterbildung die Qualität ihrer Unterrichtsgespräche in Richtung dialogischer und fachdidaktisch gehaltvoller Gespräche weiterentwickeln können. Im Vortrag werden die Konzeption und Umsetzung sowie einige Wirkungen der Fortbildung Socrates 2.0 anhand ausgewählter Ergebnisse vorgestellt und diskutiert.
Organisation
Rebekka Studler, Claudia Hefti, Judith Kreuz
Afra Sturm, Stefan Hauser, Dieter Isler, Britta Juska-Bacher, Hansjakob Schneider
An der dritten Wintertagung des nets21 spricht Prof. Dr. Johannes König (Department Erziehungs- und Sozialwissenschaften, Universität zu Köln) zum Kompetenzerwerb und zur Professionalisierung (angehender) Lehrkräfte. Zu diesem Vortrag mit anschliessender Diskussion sowie einem gemeinsamen Mittagessen sind Interessierte herzlich eingeladen.
An einer internen Sitzung am Nachmittag wird ausserdem mit der Kerngruppe und der Programmgruppe aus verschiedenen Fachdidaktiken die Sommertagung 2024 des nets21 geplant. Schwerpunkt ist die Diskussion zum Thema der „Professionalisierung“ in Bezug auf fachliche Lehr-Lernprozesse und ihre Sprachlichkeit.
Öffentlicher Fachvortrag:
Johannes König (Universität zu Köln): Wirkt Lehrerinnen- und Lehrerbildung? Interdisziplinäre Perspektiven und empirische Befunde zum Kompetenzerwerb und zur Professionalisierung (angehender) Lehrkräfte
Die Frage nach Wirksamkeit der Lehrerinnen- und Lehrerbildung wird seit vielen Jahren wiederkehrend thematisiert, hat sie doch wichtige Implikationen für die Beschreibung und Bewertung von Prozessen der Professionalisierung angehender wie berufstätiger Lehrpersonen. Im Vortrag wird zunächst eine interdisziplinäre Überblicksperspektive eingenommen: Berichtet wird über einen aktuell erschienenen Überblick zur Literatur der Forschung zur Wirksamkeit von Lehrerinnen- und Lehrerbildung (König et al., 2023). Ausgehend von den dort identifizierten Forschungslücken werden sodann ausgewählte empirische Befunde aus aktuellen Untersuchungen zur fachdidaktischen Professionalisierung, unter anderem in den Fächern Deutsch und Mathematik, sowie aus einer Makro-Perspektive zu fachübergreifenden Kompetenzen gegeben. Die sich daraus ergebenden Perspektiven für zukünftige Forschung sowie Implikationen für die Gestaltung der Lehrerinnen- und Lehrerbildung sollen anschließend zur Diskussion gestellt werden.
Literatur:
König, J., Heine, S., Kramer, Ch., Weyers, J., Becker-Mrotzek, M., Großschedl, J., Hanisch, Ch., Hanke, P., Hennemann, Th., Jost, J., Kaspar, K., Rott, B., & Strauß, S. (2023). Teacher education effectiveness as an emerging research paradigm: A synthesis of reviews of empirical studies published over three decades (1993-2023). Journal of Curriculum Studies. https://doi.org/10.1080/00220272.2023.2268702
Organisation
Rebekka Studler, Claudia Hefti, Judith Kreuz
Afra Sturm, Stefan Hauser, Dieter Isler, Britta Juska-Bacher, Hansjakob Schneider